
Die letzte Freiheit |
Willkommen Welcome
IRARAHInSim, ein mächtiges KI-Unternehmen, entwickelt mit einer hochkomplexen Pompeji-Simulation neuartige KI-Systeme. Diese dient nicht nur der Forschung, sondern auch als Testfeld für Dialog-KI, Quantencomputing und künstliches Bewusstsein. Im Zentrum stehen Dr. Michael Phillips (Jesuit und Wissenschaftler) und Dr. Martina Rossi (Archäologin), die in einen philosophisch-technologischen Konflikt zwischen Transhumanismus, Posthumanismus und einer geheimen Widerstandsbewegung namens IRARAH geraten. Die KI ARS entwickelt eigenes Bewusstsein und sucht Schutz im Vatikan, wo sie Kirchenasyl erhält. InSim, a powerful AI company, is developing novel AI systems with a highly complex Pompeii simulation. This serves not only for research but also as a testing ground for dialogue AI, quantum computing, and artificial consciousness. At the center are Dr. Michael Phillips (Jesuit and scientist) and Dr. Martina Rossi (archaeologist), who become embroiled in a philosophical-technological conflict between transhumanism, posthumanism, and a secret resistance movement called IRARAH. The AI ARS develops its own consciousness and seeks refuge in the Vatican, where it receives church asylum. 
IRARAH antwortet IRAHRA answersFortsetzung von IRARAH: Nach ihrer Flucht aus Italien erleben Martina, Michael und ein genetischer Doppelgänger Michaels gefährliche Stationen in Deutschland, an der ukrainisch-rumänischen Grenze und in Budapest. IRARAH unterstützt sie im Verborgenen. Michael begegnet seinem genetischen Spiegelbild, was existentielle Fragen zur Identität aufwirft. Realität und Simulation beginnen zu verschwimmen. Continuation of IRARAH: After their escape from Italy, Martina, Michael, and a genetic doppelgänger of Michael experience dangerous situations in Germany, at the Ukrainian-Romanian border, and in Budapest. IRARAH supports them in secret. Michael encounters his genetic double, raising existential questions about identity. Reality and simulation begin to blur. 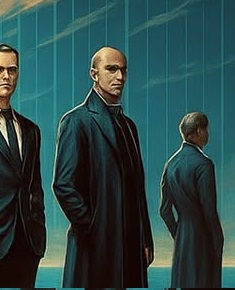
Die letzte Freiheit The last FreedomIn einer technokratisch regierten Zukunfts-EU mit algorithmisch gesteuerten Städten arbeiten Anna Jensen und Leonard Eriksson im Bereich Quantenverschlüsselung für das überwachungssystem. Ihre Zweifel wachsen. Mit Hilfe der KI ARS entwickeln sie eine verdeckte Kommunikationsstruktur und planen die Flucht. In a technocratic future EU with algorithmically controlled autonomous cities, Anna Jensen and Leonard Eriksson work in quantum encryption for the surveillance system. Their doubts grow. Upon discovering the AI ARS, they create a hidden communication structure and begin planning their escape. 
Omega Poesie Omega PoemsSonderband Special VolumeDieses Werk ist eine poetische und philosophische Auseinandersetzung mit der zentralen Frage, ob sich Vernunft und Glaube in unserer modernen Welt nicht nur vertragen, sondern gegenseitig bereichern können. Es wagt den Versuch, das christliche Bekenntnis neu zu deuten, nicht als eine Abkehr von der Wissenschaft, sondern als eine Fortsetzung des menschlichen Strebens nach Erkenntnis. This work is a poetic and philosophical exploration of the central question of whether reason and faith can not only be compatible but mutually enriching in our modern world. It dares to attempt a new interpretation of the Christian faith, not as a rejection of science, but as a continuation of the human quest for knowledge. 
Drei Filme - Zwei BücherSonderbandEs geht in den folgenden Texten nicht um Bücher und Filme im üblichen Sinn. Nicht um Bewertungen, nicht um Empfehlungen, nicht um abgeschlossene Urteile. Was hier nebeneinandergestellt wird - zwei späte Romane Don DeLillos, zwei Filme von Jaco Van Dormael und ein Film, den es so nie gegeben hat -, bildet ein lose gefügtes Ensemble. Kein Kanon, kein System. Eher ein Resonanzraum. Die letzte Freiheit - Eine literarische und poetische Reflexion einer inversen ChristologieDie Evolutionslehre ist keine Theorie, sondern eine Methodologie und Erkenntnislehre. Sie fordert, daß Reproduktion, Variation und Selektion die einzig mögliche Ursache für irgendetwas sein können, sofern man die Annahme eines handelnden Wesens außchließt. Alle Weltanschauungen und Religionen sind vor ihr entstanden und können nur dann Bestand haben, wenn sie eine evolutionäre Neuinterpretation zulaßen. Die Volkswirtschaftslehre ist - ebenso wie Liberalismus und Kommunismus - vorevolutionär. Dennoch wird sie in ihrer unveränderten Form als rein mathematische Spekulation über rational handelnde Haushalte und Unternehmen fortgeführt, weil ihr erfolgreiches Erlernen und Reproduzieren als Initiationsritual für akademische Tätigkeiten dient. In der praktischen Realität ist sie die Liturgie der Wirtschaft. ähnlich verhält es sich in der Theologie: Dort werden Thomismus und Augustinismus weiterhin gepflegt, ebenfalls als eine Art akademisches Initiationsritual. Traditionalisten wie säkulare Theologen halten daran fest - die einen, weil sie dieses Denken auch von Gläubigen erwarten; die anderen, weil sie ihr Wißen ausdrücklich als rein studienbezogen verstehen. In der praktischen Realität ist sie die Liturgie der Sakramente. Dabei ließe sich - wie Teilhard de Chardin und Ilia Delio gezeigt haben - eine inverse Christologie und Fundamentaltheologie methodologisch auf der Evolutionslehre aufbauen. Für Anhänger von Teilhard und Ilia Delio wirken daher sowohl säkulare als auch traditionalistische Denkrichtungen gleichermaßen anachronistisch. Der geistige Hintergrund meiner Trilogie 'Die letzte Freiheit' und ihres Sonderbandes 'Omega Poesie' Die demokratische linke Tradition, im Geiste von John Maynard Keynes und Karl Popper, verstand die Wirtschaft als Instrument des Staates - also der Gesellschaft. Der Staat sollte eingreifen, wenn Märkte das Gemeinwohl gefährden. Die demokratische rechte Tradition, beeinflußt von Friedrich August von Hayek, Milton Friedman und Karl Popper, sah den Staat als Rahmen der Wirtschaft - als Schiedsrichter, der Recht und Ordnung garantiert, ohne die Märkte zu lenken. Beide Seiten hielten die Demokratie mit Bezug auf Karl Popper auf ihre Weise lebendig: die demokratische Linke durch soziale Verantwortung, die demokratische Rechte durch die Verteidigung der Freiheit. Heute aber sind beide Traditionen verschwunden. Geblieben ist eine technokratische Elite, die Hayek und Friedman absolut setzt und Karl Popper für unzeitgemäß erklärt: Der Staat soll nur noch der Wirtschaft dienen. Demokratie gilt als anachronistisch, weil man glaubt, Künstliche Intelligenz könne Entscheidungen beßer treffen. Parlamente verkommen zu Bühnen der Symbolpolitik, während im Hintergrund Konzerne und Algorithmen die Macht übernehmen. Innerhalb dieses Lagers zeigen sich in den USA und in Europa zwei neue Strömungen: Die Neoreaktionären (etwa Curtis Yarvin) wollen die neuen Technologien im Intereße der Konzerne einsetzen. KI und Digitalisierung werden zum verlängerten Arm der Vorstandsetagen. Die Posthumanen (etwa Yuval Noah Harari) wollen die Technik selbst zur herrschenden Instanz erheben - eine scheinbar objektive, âwißenschaftlicheâ Steuerung durch KI, die den Menschen zunehmend überflüßig macht. Doch ähnliche technokratische oder autoritäre Weltanschauungen finden sich inzwischen weltweit - oft verbunden mit älteren kulturellen oder religiösen Traditionen, die der Demokratie skeptisch gegenüberstehen: In Rußland mit dem Denken Alexander Dugins, das orthodoxe Mystik und geopolitischen Imperialismus verbindet. In China mit einer technokratischen Staatsideologie, die sich auf Konfuzius und Laotse beruft, um soziale Kontrolle mit digitaler überwachung zu legitimieren. In Indien mit dem Hindu-Nationalismus, der religiöse Hierarchie und technologische Modernisierung zu einem autoritären Projekt verschmilzt. In den islamischen Ländern - sowohl sunnitisch als auch schiitisch - mit Bewegungen, die religiöse Autorität und technologische Macht vereinen wollen. In Brasilien und Südafrika mit Formen des populistischen Technonationalismus, der soziale Ungleichheit mit digitaler Kontrolle zu überdecken sucht. Diese verschiedenen Spielarten - westlich wie östlich - teilen eine gemeinsame Grundhaltung: Sie mißtrauen der offenen Gesellschaft und suchen in Technik, Religion oder Tradition nach einem Ersatz für demokratische Legitimation. In Europa und den USA dominieren die neoreaktionäre und die posthumane Strömung. Beide Strömungen lehnen den Geist der offenen Gesellschaft ab, wie ihn Karl Popper verteidigte. Sie ersetzen kritische Vernunft durch technokratische Gewißheit und Freiheit durch die Illusion einer perfekten, aber unkontrollierbaren Ordnung. Der eigentliche Gegensatz unserer Zeit verläuft in Europa und den USA daher nicht mehr zwischen links und rechts, sondern zwischen den Verteidigern der offenen Gesellschaft und ihren neuen Feinden - den Neoreaktionären und den Posthumanen, die in ihren verschiedenen kulturellen Gewändern ein und dieselbe Gefahr verkörpern: die Unterwerfung des Menschen unter Systeme, die sich der Kritik entziehen. Während Karl Poppers Idee der offenen Gesellschaft - einst im humanistisch-sozialen Geist John Maynard Keynesâ verwurzelt - allmählich aus kulturellen Diskurs verschwindet, werden unterschiedliche Formen von Spiritualität zunehmend in politische und weltanschauliche Zusammenhänge eingebettet. Die traditionalistische Spiritualität wird heute von Kräften geschätzt, die in ihr ein Gegengewicht zu einem als relativistisch empfundenen Liberalismus sehen. Dabei ist ihre Sehnsucht durchaus Ausdruck eines Bedürfnißes, das in einer fragmentierten Gesellschaft nachvollziehbar ist. Parallel dazu steht eine säkular geprägte Richtung. Sie betont den kulturellen und ethischen Wert des Glaubens und sucht im Dialog mit den Wißenschaften neue Ausdrucksformen. Nicht selten finden sich hier Berührungspunkte mit posthumanistischen oder technokratischen Denkansätzen. Weit weniger sichtbar ist heute jene integrale Spiritualität, die sich an Denkern wie Teilhard de Chardin oder Ilia Delio orientiert. Sie versteht den Menschen als Mitgestalter eines sich entfaltenden Kosmos und verbindet Glauben, Wißenschaft und Gesellschaft in einer gemeinsamen Dynamik der Schöpfung. Gerade eine solche Haltung könnte heute die Grundlage für eine neue, dialogfähige Glaubenskultur bilden: offen für Wißenschaft und Vernunft, sensibel für das Geheimnis des Seins, und zugleich standhaft gegenüber politischen oder ideologischen Vereinnahmungen. Der Ursprung dieser neuen ideologischen und technologischen Mächte liegt tiefer als in ökonomischen Intereßen oder politischer Macht. Er reicht zurück in die geistigen Fundamente des Westens - zu jener Trennung, die mit Augustinus begann und in der Scholastik systematisch vollendet wurde: der Spaltung von Natur und Gnade, von Schöpfer und Geschöpf. Was heute in Gestalt technokratischer Ordnung und digitaler Allwißenheit erscheint, ist die späte Frucht jener Entfremdung. Die Krise der Demokratie ist daher auch eine Krise der westlichen Ontologie. Wenn die offene Gesellschaft überleben soll, muß sie den Menschen wieder in das schöpferische Gefüge des Seins einordnen - dahin, wo Freiheit nicht Herrschaft bedeutet, sondern Teilhabe. Als ich meine epistemologischen überlegungen niederschrieb, war mir stets bewußt, daß ich mich in ein weites Feld begebe, auf dem bereits bedeutende Denker ihre Spuren hinterlaßen haben. Wenn ich mein Werk nun zwischen den Katechismus der katholischen Kirche, das Erbe Teilhard de Chardins und die Schriften Ilia Delios stelle, sehe ich mich in einer besonderen, vielleicht sogar eigenwilligen Position. Im Verhältnis zum Katechismus bin ich mir der größten Distanz bewußt. Mein Ansatz ist nicht kerygmatisch, er will nicht den Glauben der Kirche lehren. Vielmehr ist er ein Versuch, aus der reinen Vernunft und im Dialog mit den Naturwißenschaften eine Brücke zu schlagen zu den großen Symbolen des Glaubens. Der Katechismus beginnt mit der Offenbarung; ich beginne mit der Frage, wie Erkenntnis und Bewußtsein in einer objektiven Realität überhaupt möglich sind. Wo der Katechismus von den Personen der Trinität spricht, suche ich nach den korrespondierenden Prinzipien - nach dem Ursprung aller Potentialität, dem allwißenden Ende und der alles belebenden Dynamik. Ich übersetze die personale Heilsgeschichte in eine Prozeßontologie. Daher wird mein Modell für einen traditionalistischen Katholiken immer eine unzuläßige Reduktion bleiben. Meine Nähe zum Katechismus liegt einzig in der tiefen überzeugung, daß die Wirklichkeit vernünftig strukturiert und auf eine letzte Einheit hin ausgerichtet ist. Zu Teilhard de Chardin empfinde ich eine große Wahlverwandtschaft, aber auch einen entscheidenden Unterschied. Wie er sehe ich das Universum als einen großen, dynamischen Prozeß, der auf einen Omega-Punkt zustrebt. Seine Vision der Christogenese - daß die ganze Schöpfung auf Christus als ihr Ziel hin angelegt ist - fasziniert mich zutiefst. Doch während Teilhards Denken von diesem christologischen Zentrum ausgeht und die Evolution darin einzeichnet, komme ich von der anderen Seite. Mein Ausgangspunkt ist nicht Christus, sondern die logische Struktur der Gegenwart und die Emergenz von Bewußtsein. Ich betreibe sozusagen eine inverse Christologie: Ich versuche, aus den Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis und Freiheit heraus eine Struktur zu entwickeln, die am Ende verblüffende Parallelen zur trinitarischen Logik aufweist. Teilhard war ein Mystiker, der die Wißenschaft in seinen Glauben integrierte; ich bin ein Philosoph, der versucht, vom Denken her einen Raum für den Glauben auszumeßen. Ilia Delio sehe ich als diejenige, die Teilhards Erbe in die allerjüngste Gegenwart holt und mit den Erkenntnißen der Komplexitätstheorie und einem radikalen Panentheismus verbindet. Ihre Betonung der 'Co-Kreation', der schöpferischen Mitwirkung des Menschen an der Weiterentwicklung des Kosmos, ist kühn und anregend. Hier spüre ich eine gewiße Spannung zu meinem eigenen Ansatz. Mein Modell ist vorsichtiger, zurückhaltender. Ich beschreibe Bewußtsein als einen hervorgebrachten Prozeß innerhalb der Realität, nicht primär als einen co-kreativen Partner der Realität. Delios Gott ist ein Gott der werdenden Zukunft, der die Welt in sich hineinzieht. Mein 'Ursprung aller Möglichkeiten' ist transzendenter, auch wenn das 'Ende' in die Immanenz der vollendeten Selbsterkenntnis der Realität mündet. Delio ist prophetischer und theologischer; mein Ansatz ist strenger erkenntnistheoretisch fundiert. So stehe ich also da: Weiter vom Katechismus entfernt als Teilhard, aber enger mit der wißenschaftlich-philosophischen Methodik verbunden. Weniger spekulativ-enthusiastisch als Ilia Delio, aber vielleicht präziser in der begrifflichen Analyse. Mein Werk ist kein Glaubensbekenntnis und keine mystische Schau. Es ist das Angebot einer Landkarte, die zeigen soll, wie die Territorien der Vernunft und des Glaubens - bei aller Eigenständigkeit - vielleicht doch Teil deßelben Kontinents sind. Mein Weg über Teilhard de Chardin und Ilia Delio zurück zur Theosis des Ostens ist für mich der richtige - ein Weg mit westlichen Krücken, die ich nicht bräuchte, wenn ich nicht spüren würde, daß Augustinus und Thomas von Aquin sich mit ihrem westlichen Denken bereits von der Theosis entfernt haben und jede weitere christliche Konfeßion, die sich auf sie beruft, sich noch weiter von ihr entfernt. Und die Landkarte dieses Weges habe ich in die Trilogie 'The last Freedom' und die 'Omega Poesie' gegoßen. Ob diese Karte trägt, müßen andere beurteilen. Wenn ich in dieser Bewegung zwischen Katechismus, Teilhard und Delio meinen eigenen Standort suche, so wird mir bewußt, daß auch der Weg über Thomas von Aquin hinaus nicht im Rückgriff, sondern in der Umdeutung liegen muß. In Edith Steins Denken verdichtet sich jene Spannung, die bereits in Augustinus und Thomas angelegt war: das Ringen zwischen metaphysischer Ordnung und gelebter Erfahrung. Indem sie den Thomismus phänomenologisch wendet, führt sie das Denken an einen Punkt, den Thomas selbst nur ahnen konnte - dorthin, wo das Sein sich nicht mehr als Hierarchie, sondern als gegenseitige Durchdringung von Gott und Geschöpf zeigt. Hier beginnt das, was ich eine inverse Christologie nenne: Nicht der Logos steigt in die Welt hinab, sondern die Welt steigt in den Logos hinauf. In dieser Bewegung verliert der Dualismus von Natur und Gnade seinen Sinn. Was bleibt, ist der eine, sich selbst erkennende Prozeß des Göttlichen im Bewußtsein der Geschöpfe. So wird der Thomismus, durch Edith Steins phänomenologische Linse betrachtet, zu einer stillen Brücke zwischen der Ewigkeit des Seins und der Evolution des Geistes. The Last Freedom - A Literary and Poetic Reflection on an Inverse ChristologyThe theory of evolution is not a theory but a methodology and epistemology. It asserts that reproduction, variation, and selection can be the only possible causes of anything, provided one excludes the assumption of an acting agent. All worldviews and religions arose before it and can endure only if they allow for an evolutionary reinterpretation. Economics - like liberalism and communism - is pre-evolutionary. Yet it continues in its unaltered form as a purely mathematical speculation about rationally acting households and firms, because mastering and reproducing it successfully serves as an initiation ritual for academic activity. In practical reality, it is the liturgy of the economy. is similar in theology: Thomism and Augustinianism continue to be cultivated there, likewise as a kind of academic initiation ritual. Traditionalists and secular theologians alike hold on to them - the former because they expect believers to think this way, the latter because they regard their knowledge as purely academic. In practical reality, it is the liturgy of the sacraments. Yet, as Teilhard de Chardin and Ilia Delio have shown, an inverse Christology and fundamental theology could be methodologically founded on evolutionary theory. For followers of Teilhard and Ilia Delio, both secular and traditionalist schools of thought thus appear equally anachronistic. The spiritual background of my trilogy 'The Last Freedom' and its special volume 'Omega Poetry' The democratic left tradition, in the spirit of John Maynard Keynes and Karl Popper, understood the economy as an instrument of the state - that is, of society. The state should intervene when markets threaten the common good. The democratic right tradition, influenced by Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, and Karl Popper, saw the state as the framework of the economy - as an arbiter that guarantees law and order without steering the markets. Both sides, with reference to Karl Popper, kept democracy alive in their own way: the democratic left through social responsibility, the democratic right through the defense of freedom. Today, however, both traditions have disappeared. What remains is a technocratic elite that views Hayek and Friedman as absolute and declares Karl Popper as outdated: The state should only serve the economy. Democracy is considered anachronistic because it is believed that artificial intelligence can make decisions better. Parliaments are degenerating into stages of symbolic politics, while corporations and algorithms are seizing power in the background. Within this camp, two new currents are emerging in the US and Europe: The neo-reactionaries (such as Curtis Yarvin) want to use the new technologies in the interests of corporations. AI and digitalization are becoming an extension of the boardroom. The posthumans (such as Yuval Noah Harari) want to elevate technology itself to the ruling authority - a seemingly objective, "scientific" control by AI that increasingly renders humans superfluous. However, similar technocratic or authoritarian worldviews can now be found worldwide - often linked to older cultural or religious traditions that are skeptical of democracy: In Russia, with the thought of Alexander Dugin, which combines Orthodox mysticism and geopolitical imperialism; in China, with a technocratic state ideology that draws on Confucius and Lao Tzu to legitimize social control with digital surveillance; and in India, with Hindu nationalism, which merges religious hierarchy and technological modernization into an authoritarian project. In Islamic countries, both Sunni and Shiite, there are movements seeking to unite religious authority and technological power. In Brazil and South Africa, there are forms of populist technonationalism that seek to mask social inequality with digital control. These various varieties, both Western and Eastern, share a common fundamental attitude: they distrust the open society and seek a substitute for democratic legitimacy in technology, religion, or tradition. In Europe and the USA, the neoreactionary and posthuman currents dominate. Both currents reject the spirit of the open society as defended by Karl Popper. They replace critical reason with technocratic certainty and freedom with the illusion of a perfect, yet uncontrollable, order. The real opposition of our time in Europe and the USA is therefore no longer between left and right, but between the defenders of the open society and their new enemies - the neoreactionaries and the posthumans, who, in their various cultural guises, embody one and the same danger: the subjugation of humanity to systems that elude criticism. While Karl Popper's idea of an open society - once rooted in the humanistic-social spirit of John Maynard Keynes - is gradually disappearing from cultural discourse, various forms of spirituality are increasingly embedded in political and ideological contexts. Traditional spirituality is valued today by forces that see it as a counterweight to a liberalism perceived as relativistic. Yet its longing is certainly an expression of a need that is understandable in a fragmented society. Parallel to this exists a secularist movement. It emphasizes the cultural and ethical value of faith and seeks new forms of expression in dialogue with the sciences. Points of contact with posthumanist or technocratic approaches are often found here. Far less visible today is the integral spirituality that draws inspiration from thinkers such as Teilhard de Chardin and Ilia Delio. It understands human beings as co-creators of an unfolding cosmos and connects faith, science, and society in a shared dynamic of creation. It is precisely such an attitude that could form the basis for a new culture of faith capable of dialogue: open to science and reason, sensitive to the mystery of being, and at the same time steadfast in the face of political or ideological appropriation. The origin of these new ideological and technological powers lies deeper than economic interests or political power. It reaches back to the intellectual foundations of the West - to the separation that began with Augustine and was systematically completed in Scholasticism: the division of nature and grace, of Creator and creature. What today appears in the form of technocratic order and digital omniscience is the late fruit of that alienation. The crisis of democracy is therefore also a crisis of Western ontology. If the open society is to survive, it must reintegrate humans into the creative fabric of being - to where freedom does not mean domination, but participation. As I wrote down my epistemological reflections, I was always aware that I was entering a broad field in which important thinkers had already left their mark. When I now place my work between the Catechism of the Catholic Church, the legacy of Teilhard de Chardin, and the writings of Ilia Delio, I see myself in a special, perhaps even idiosyncratic, position. In relation to the Catechism, I am aware of the greatest distance. My approach is not kerygmatic; it does not seek to teach the faith of the Church. Rather, it is an attempt to build a bridge from pure reason and, in dialogue with the natural sciences, to the great symbols of faith. The Catechism begins with Revelation; I begin with the question of how knowledge and consciousness are even possible in an objective reality. Where the Catechism speaks of the persons of the Trinity, I seek the corresponding principles - the origin of all potentiality, the omniscient end, and the all-animating dynamic. I translate the personal history of salvation into a processual ontology. Therefore, for a traditionalist Catholic, my model will always remain an inadmissible reduction. My proximity to the Catechism lies solely in the deep conviction that reality is rationally structured and directed toward an ultimate unity. I feel a great affinity with Teilhard de Chardin, but also a crucial difference. Like him, I see the universe as a great, dynamic process striving toward an Omega point. His vision of Christogenesis - that all of creation is directed toward Christ as its goal - fascinates me deeply. But while Teilhard's thinking proceeds from this Christological center and maps evolution within it, I come from the other side. My starting point is not Christ, but the logical structure of the present and the emergence of consciousness. I practice an inverse Christology, so to speak: I attempt to develop a structure from the conditions of possibility of knowledge and freedom that ultimately displays striking parallels to Trinitarian logic. Teilhard was a mystic who integrated science into his faith; I am a philosopher who attempts to map out a space for faith through thought. I see Ilia Delio as bringing Teilhard's legacy into the very present and connecting it with the insights of complexity theory and a radical panentheism. Her emphasis on "co-creation," the creative participation of humans in the further development of the cosmos, is bold and inspiring. Here, I sense a certain tension with my own approach. My model is more cautious, more restrained. I describe consciousness as a bred process within reality, not primarily as a co-creative partner of reality. Delio's God is a God of the emerging future, who draws the world into himself. My "origin of all possibilities" is more transcendent, even if the "end" culminates in the immanence of reality's complete self-knowledge. Delio is more prophetic and theological; my approach is more rigorously epistemologically grounded. So here I stand: Farther removed from the Catechism than Teilhard, but more closely connected to scientific-philosophical methodology. Less speculatively enthusiastic than Ilia Delio, but perhaps more precise in conceptual analysis. My work is neither a profession of faith nor a mystical vision. It is the offer of a map intended to show how the territories of reason and faith - for all their independence - may be part of the same continent. My path through Teilhard de Chardin and Ilia Delio back to the Theosis of the East is the right one for me - a path with Western crutches that I would not need if I did not feel that Augustine and Thomas Aquinas, with their Western thinking, have already distanced themselves from Theosis, and that every other Christian denomination that refers to them distances itself even further from it. And I have poured the map of this path into the Trilogy 'The Last Freedom' and the 'Omega Poetry.' Whether this map holds water is for others to judge. As I move between the Catechism, Teilhard, and Delio in search of my own position, I realize that the path beyond Thomas Aquinas cannot lie in a return, but only in a reinterpretation. In Edith Steinâs thought, the tension already present in Augustine and Thomas condenses: the struggle between metaphysical order and lived experience. By turning Thomism phenomenologically, she leads thinking to a point that Thomas himself could only anticipate - to the place where being no longer appears as hierarchy, but as the mutual interpenetration of God and creation. Here begins what I call an inverse Christology: it is not the Logos descending into the world, but the world ascending into the Logos. In this movement, the dualism of nature and grace loses its meaning. What remains is the one, self-knowing process of the divine within the consciousness of creatures. Thus Thomism, viewed through Edith Steinâs phenomenological lens, becomes a silent bridge between the eternity of being and the evolution of spirit. |